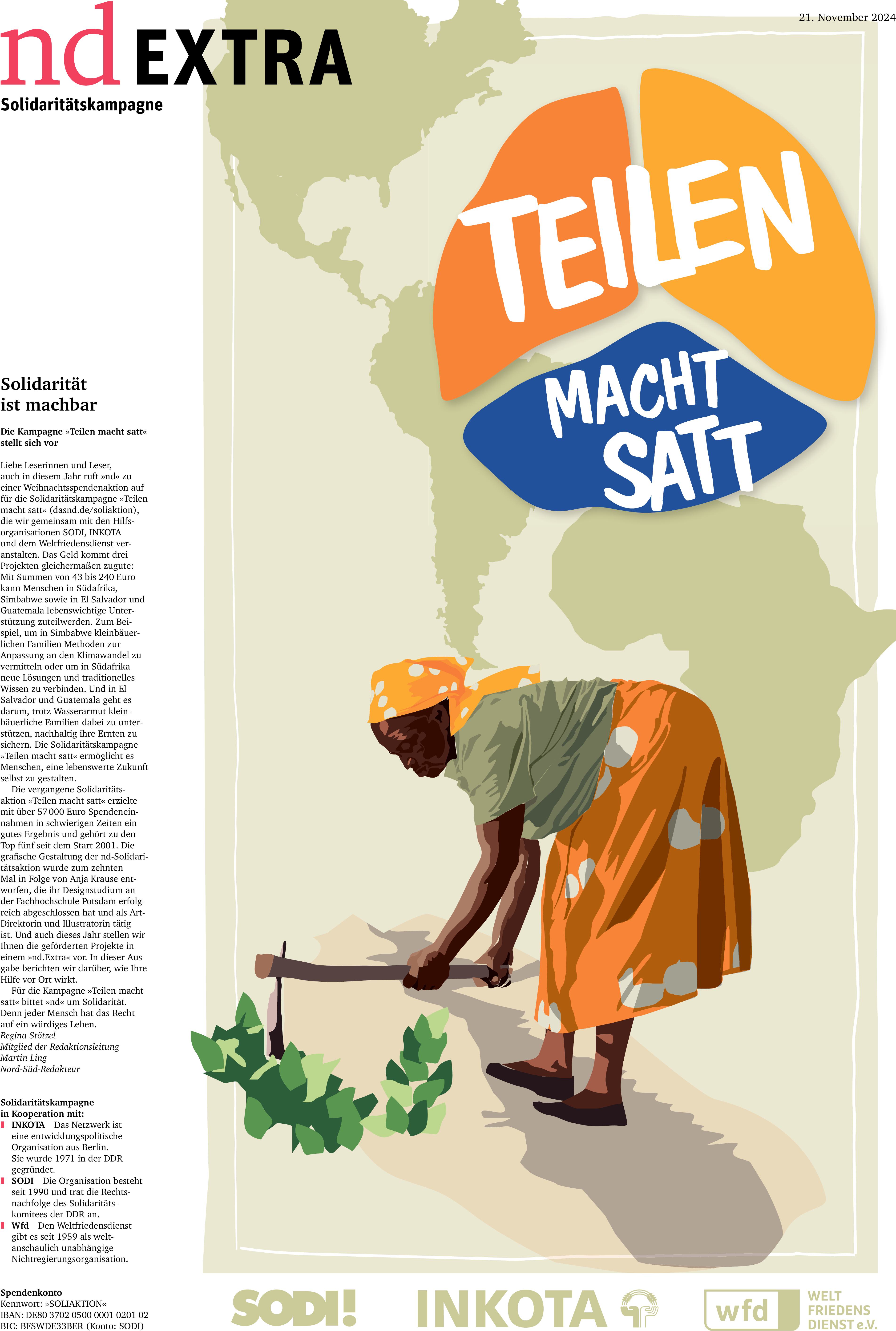
Solidaritätskampagne
Liebe Leserinnen und Leser,
auch in diesem Jahr ruft »nd« zu
einer Weihnachtsspendenaktion auf
für die Solidaritätskampagne »Teilen
macht satt« (dasnd.de/soliaktion),
die wir gemeinsam mit den Hilfs-
organisationen SODI, INKOTA
und dem Weltfriedensdienst ver-
anstalten. Das Geld kommt drei
Projekten gleichermaßen zugute:
Mit Summen von 43 bis 240 Euro
kann Menschen in Südafrika,
Simbabwe sowie in El Salvador und
Guatemala lebenswichtige Unter-
stützung zuteilwerden. Zum Bei-
spiel, um in Simbabwe kleinbäuer-
lichen Familien Methoden zur
Anpassung an den Klimawandel zu
vermitteln oder um in Südafrika
neue Lösungen und traditionelles
Wissen zu verbinden. Und in El
Salvador und Guatemala geht es
darum, trotz Wasserarmut klein-
bäuerliche Familien dabei zu unter-
stützen, nachhaltig ihre Ernten zu
sichern. Die Solidaritätskampagne
»Teilen macht satt« ermöglicht es
Menschen, eine lebenswerte Zukunft
selbst zu gestalten.
Die vergangene Solidaritäts-
aktion »Teilen macht satt« erzielte
mit über 57 000 Euro Spendenein-
nahmen in schwierigen Zeiten ein
gutes Ergebnis und gehört zu den
Top fünf seit dem Start 2001. Die
grasche Gestaltung der nd-Solidari-
tätsaktion wurde zum zehnten
Mal in Folge von Anja Krause ent-
worfen, die ihr Designstudium an
der Fachhochschule Potsdam erfolg-
reich abgeschlossen hat und als Art-
Direktorin und Illustratorin tätig
ist. Und auch dieses Jahr stellen wir
Ihnen die geförderten Projekte in
einem »nd.Extra« vor. In dieser Aus-
gabe berichten wir darüber, wie Ihre
Hilfe vor Ort wirkt.
Für die Kampagne »Teilen macht
satt« bittet »nd« um Solidarität.
Denn jeder Mensch hat das Recht
auf ein würdiges Leben.
Regina Stötzel
Mitglied der Redaktionsleitung
Martin Ling
Nord-Süd-Redakteur
Solidaritätskampagne
in Kooperation mit:
❚INKOTADas Netzwerk ist
eine entwicklungspolitische
Organisation aus Berlin.
Sie wurde 1971 in der DDR
gegründet.
❚SODIDie Organisation besteht
seit 1990 und trat die Rechts-
nachfolge des Solidaritäts-
komitees der DDR an.
❚WfdDen Weltfriedensdienst
gibt es seit 1959 als welt-
anschaulich unabhängige
Nicht regie rungs organisation.
Spendenkonto
Kennwort: »SOLIAKTION«
IBAN: DE80 3702 0500 0001 0201 02
BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)
Die Kampagne »Teilen macht satt«
stellt sich vor
Solidarität
ist machbar
21. November 2024

HELEN BAUERFEIND, WFD
Im Mai dieses Jahres musste Simbab-
we den Katastrophenfall ausrufen: Das
Wetterphänomen El Niño sorgte für
eine lange Dürreperiode, sodass 40 bis
60 Prozent der gesamten Ernte verlo-
ren gingen. Es war ein erneuter, hefti-
ger Schlag für die Menschen im Land.
Simbabwe bendet sich schon lan-
ge in einer schweren politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Krise. Zu den
langen Trockenperioden, die zu verkürz-
ten Anbauzeiten und schlechten Ernten
führten, kamen infolge des russischen
Angriskrieges gegen die Ukra ine er-
höhte Kosten für Düngemittel. Aber
auch die Preise für Grundnahrungs-
mittel stiegen weiter an. Die sowieso
schon hohe Ination verschärfte sich.
Heute ändern sich zum Beispiel die Le-
bensmittelpreise ständig. Auch Strom-
und Treibsto preise unterliegen starken
Schwankungen.
Die Hälfte der Bevölkerung lebt in
extremer Armut, Mangelernährung ist
weitverbreitet. Die meisten Menschen
in Simbabwe arbeiten in der Landwirt-
schaft und überleben von dem, was sie
selbst auf kleinen, oft wenig fruchtba-
ren Feldern anbauen. Häug können
die ausgetrockneten Böden den weni-
gen Regen nicht mehr aufnehmen, und
es kommt zu Überschwemmungen, die
die Ernten vollends vernichten. Die
Menschen vor Ort brauchen deshalb
mehr Wissen darüber, wie sie sich an
geänderte Umweltbedingungen anpas-
sen und unabhängig von teurem Saat-
gut werden können.
Hier setzt unsere Partnerorganisa-
tion PELUM Zimbabwe (Participatory
Ecological Land Use Management Zim-
babwe) an: Als Netzwerkorganisation
bringt sie zivilgesellschaftliche Grup-
pen zusammen, die direkt mit Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern arbeiten.
So ist eine Plattform für Austausch und
gemeinsames Lernen entstanden. Das
Ziel ist, agrar öko logische Anbaumetho-
den zu stärken, die ressourcenschonend
sind und in Harmonie mit der Natur ste-
hen. Denn so bleiben die Böden frucht-
bar und werden nicht übernutzt. Zudem
fördert PELUM gemeinsame Strategien,
wie Land- und Weideächen nachhal-
tig für Vieh- und Landwirtschaft genutzt
werden können. Ein weiterer wichtiger
Bestandteil des Programms ist selbstver-
waltetes Saatgut.
Grundlage ist die Erkenntnis, dass
man zusammen mehr erreichen kann. Es
ist wichtig, mit einer kollektiven Stimme
– etwa gegenüber staatlichen Entschei-
dungsträger*innen – aufzutreten, Prob-
leme gemeinschaftlich anzugehen und
überholte landwirtschaftliche Praktiken
aufzugeben, weil sie Menschen davon
abhalten, auf die Natur achtzugeben.
Neue Ansätze in der Landwirtschaft
sind überlebensnotwendig
Simbabwe
leidet unter Dürre
❚SIMBABWE
HELEN BAUERFEIND, WFD
M
ashonaland ist eine
Provinz im Nordos-
ten Simbabwes. Hier
erwirtschaften die
meisten Menschen
ihre Nahrungsmittel
in kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Seit ei-
nigen Jahren gibt es in diesem Gebiet im-
mer längere Dürreperioden, Stürme und
Überschwemmungen. Dadurch wird es
für die Kleinbäuerinnen und -bauern noch
schwerer, zum Leben ausreichende Ernten
einzufahren. Hinzu kommt, dass der Staat
den Einsatz hybrider Saatgut sorten sub-
ventioniert und die wirtschaftliche Unab-
hängigkeit der kleinbäuerlichen Betriebe
beeinträchtigt oder verhindert.
Plaxedes Kaseske ist Kleinbäuerin. Sie
lebt in Juru in Goromonzi, einer ländli-
chen Gemeinde südöstlich der Haupt-
stadt Harare. Heute baut sie verschiede-
ne traditio nelle Hirse- und Maissorten an,
die sie schon seit Kindertagen kennt. Dazu
bringt Plaxedes Kaseske ihr eigenes Saat-
gut aus oder verwendet Samen, die sie
auf einem der regelmäßig stattndenden
Saatgut märkte getauscht hat. Darüber ist
Plaxedes sehr glücklich: »Durch die Ver-
wendung meines eigenen Saatguts kann
ich Geld sparen, das ich sonst für den Kauf
von Hybridsaatgut verwendet hätte. Au-
ßerdem brauche ich keine zusätzlichen
Stoe wie synthetische Düngemittel und
Chemikalien. Ich verwende mein Saatgut
und bin unabhängig.«
In vielen Ländern des Globalen Südens
wird der Einsatz von hybriden Saatgut-
sor ten seit Jahrzehnten staatlich geför-
dert. Hybridzüchtung bringt Sorten hervor,
die in der ersten Generation besonders er-
tragreich sind, aus denen sich aber keine
neuen Saaten züchten lassen. Das Saatgut
muss also jedes Jahr neu beschat werden.
Hy bri des Saatgut, aggressive Schädlings-
und Unkrautbekämpfungsmittel und che-
mische Dünger sind weitverbreitet – nicht
zuletzt aufgrund staatlicher Subventio-
nen. Das führt nicht nur zu Abhängigkeit,
sondern auch dazu, dass Wasser und Bö-
den verschmutzt und ausgelaugt werden.
Es kommt immer mehr zu Konikten in-
nerhalb der Gemeinden, vor allem um die
knappe Ressource Wasser.
Plaxedes Kaseske ist eine Saatgutpio-
nierin. Für viele ihrer Nachbar*innen ist
die Verwendung von eigenem Saatgut hin-
gegen nicht selbstverständlich. Restriktive
Saatgutgesetze verbieten es ihnen sogar,
ihr eigenes Saatgut auszusäen oder zu tau-
schen. »Es gibt noch viel zu tun, damit das
Saatgut von allen Kleinbauern anerkannt
wird«, so Kaseke.
Hier kommt unsere Partnerorganisati-
on PELUM Zimbabwe (Participatory Eco-
logical Land Use Management) ins Spiel.
Seit ihrer Gründung 1995 unterstützt sie
Kleinbäuerinnen und -bauern in Simbabwe
dabei, nachhaltige Anbaumethoden umzu
-
setzen. Dafür hat PELUM mit ihren Part-
nern verschiedene Programme aufgelegt.
In Trainings und Workshops vermitteln sie
den Menschen in der Region agrarökologi-
sche Anbaumethoden. Sie bringen bäuerli-
che Gemeinschaften zusammen, damit sie
über die Nutzung ihrer Land- und Weide-
ächen gemeinsam beraten und Übernut-
zung vermeiden. Zudem sorgen sie dafür,
dass sich degradierte und vom Klimawan-
del betroene Landschaften mithilfe ge-
planter Beweidung regenerieren können.
PELUM sucht den Kontakt zu Politik und
Öentlichkeit, um Märkte für agraröko-
logische Produkte zu schaen. Und nicht
zuletzt fördert PELUM selbstverwaltete
Saatgut systeme und veranstaltet Saatgut-
märkte und -messen.
Nach Erfahrungen mit Extremwetter-
ereignissen wie dem Tropensturm »Idai«
im März 2019, der riesige Flächen über-
schwemmte und viele Getreidelager zer-
störte, existieren heute zahlreiche Saatgut-
banken. Hier wird das Saatgut einer Reihe
von Nutzpanzen wie Okra, Hirse, Mani-
ok, Sor ghum, Erdnüsse und Mais gelagert.
Die Saatgutbanken bieten eine Art Versi-
cherung: Wird die Ernte etwa durch eine
Überschwemmung zerstört, können die
Kleinbäuerinnen und -bauern der Re gion
das gelagerte Saatgut nutzen. Oft werden
dort auch traditionelle Saatgut sorten auf-
bewahrt, die von den hybriden Sorten ver-
drängt wurden und vom Aussterben be-
droht waren.
Saatgutsouveränität bedeutet für die
Kleinbäuerinnen und -bauern, dass sie die
Kontrolle über ihr Saatgut haben – dass sie
uneingeschränkten Zugang zu hochwerti-
gem Saatgut haben und es selbst produ-
zieren können. Und dass sie dafür nicht
kriminalisiert werden. Denn große multi-
nationale Unternehmen sind daran nicht
interessiert und betreiben Lobbyarbeit,
um Patente für bestimmte Panzensorten
einzuführen.
Saatgutsouveränität bedeutet auch,
dass Kleinbäuerinnen und -bauern mit-
entscheiden können über das gemein-
schaftlich verwendete Saatgut – hier geht
es um Verbesserung, Auslese, Quantität
und Diversität. Im Ergebnis werden Sor-
ten gewählt, die gut an die lokalen Um-
weltbedingungen angepasst sind: Sie sind
dürre tolerant und wachsen auch auf kar-
gen Böden.
Das Zimbabwe Seed Sovereignty Pro-
gramme (ZSSP; Saatgutsouveränitäts-Pro-
gramm Simbabwe), das im Jahr 2014 von
sieben NGOs und landwirtschaftlichen Or-
ganisationen gegründet wurde, stärkt die
Saatgutproduktion und -erhaltung auf
Ebene der Haushalte und Gemeinden. Es
führt Aktivitäten und Workshops zu Saat-
gutsouveränität im ganzen Land durch.
So wie Plaxedes Kaseske betreiben mitt-
lerweile viele Kleinbäuerinnen und -bau-
ern in Simbabwe nachhaltige Landwirt-
schaft und schützen dadurch natürliche
Ressourcen wie Boden, Wasser und Biodi-
versität. Dadurch entstehen weniger Kon-
ikte um diese Ressourcen. Indem unsere
Partnerorganisation PELUM die Menschen
vor Ort zusammenbringt und gemein-
schaftliche Ansätze für den Ressourcen-
schutz entwickelt, stärkt sie Solidarität, so-
ziale Bindungen und den sozialen Frieden.
Eine nachhaltige und gerechte Land-
wirtschaft trägt wesentlich zu friedlichen
Bedingungen bei, deshalb unterstützt der
Weltfriedensdienst e. V. die agrarökologi-
schen Projekte von PELUM. Der Weg ist
noch weit, aber die bisherigen Erfolge
zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg!
Immer mehr Kleinbäuerinnen und -bau-
ern erkennen die vielen Vorteile und stei-
gen auf nachhaltigen Landbau um, damit
sie aus eigener Kraft der Armut entkom-
men. Wir können sie dabei mit Spenden
unterstützen.
»Durch die
Verwendung meines
eigenen Saatguts
kann ich Geld
sparen, das ich
sonst für den Kauf
von Hybridsaatgut
verwendet hätte.«
Plaxedes Kaseske Kleinbäuerin
Wie kleinbäuerliche Betriebe im Nordosten Simbabwes durch nachhaltigen
Landbau unabhängig werden
Eigenes Saatgut
ISABELL NORDHAUSEN, INKOTA
Der Klimawandel ist allgegenwärtig.
Er ist längst Realität geworden, und
Wetterextreme schlagen vor allem
in den Ländern des Globalen Südens un-
erbittlich zu. So wurde das zentralameri-
kanische Land Guatemala in den vergan-
genen Jahren immer wieder von schweren
Dürren und einer Rekordhitze heimgesucht.
Die Folge sind Hungersnöte und alarmie-
rend hohe Raten an chronischer Mangeler-
nährung bei Kindern.
Ende 2023: Die Vorräte der wichtigen
Grundnahrungsmittel Mais und Bohnen
von Ludving Everardo Orellana Sandoval
und seiner Familie neigen sich dem Ende
zu. In ihrer Gemeinde El Garay im Land-
kreis Monjas im Trockenkorridor von Gu-
atemala ist die Regenzeit mal wieder viel
zu kurz ausgefallen. Immer öfter kommt es
zu schlimmen Dürren, verbunden mit Ern-
teausfällen. Die Regenzeit beginnt zu spät,
und selbst in der Regenzeit gibt es länge-
re Phasen komplett ohne Regen. »Vergan-
genes Jahr hat es viel zu wenig geregnet,
der Großteil meiner Bohnenpanzen ist
schlichtweg verdorrt. Auch Mais konnten
wir nur wenig ernten.« Dies ist ein har-
ter Schlag für Ludving Everardo Orellana
Sandoval, seine Frau und ihre zwei Kinder.
Denn: »Mit dem, was wir ernten, müssen
wir überleben.«
Durch Dürrezeiten haben sie immer wie-
der große Teile ihrer Ernten verloren. Auch
die Erosion des Bodens nimmt zu und er-
schwert den Anbau. Ludving Everardo Orel-
lana Sandoval erzählt: »Die Erträge unserer
Ernte sind von Mal zu Mal schlechter. Die
Erde ist einfach zu trocken. Zugang zu Lei-
tungswasser haben wir nur alle zwei Tage
für zwei Stunden. Das Wasser reicht gerade
so für das Nötigste im Haushalt – fürs Trin-
ken, Kochen und Waschen. Zum Bewässern
unserer Beete dürfen wir es nicht verwen-
den.« Doch wenn die Beete nicht bewässert
werden, verdorrt die Ernte. So wie Orella-
na geht es vielen indigenen Kleinbauern-
familien. Dürren bedeuten hier vor allem
eins: Hunger. Fast die Hälfte der Kinder in
Guatemala sind chronisch mangelernährt.
Das ist eine der höchsten Raten weltweit.
Die Armut hat in den vergangenen Jahren
sogar noch zugenommen, und die Schere
zwischen Arm und Reich klat immer wei-
ter auseinander.
Im Frühjahr 2024 kam für die Gemeinde,
in der die Familie von Ludving Orellana lebt,
der Wendepunkt: Die INKOTA-Partnerorga-
nisation, das Kollektiv Madre Selva (CMS),
unterstützte den Bau eines großen Regen-
wasser-Auangbeckens. Ein ausgetrockne-
tes Flussbett, das ausschließlich während
der jährlichen Regenzeit Wasser führt, wur-
de an einer Engstelle mit einer Staumauer
versehen, damit zumindest ein Teil des Re-
genwassers gespeichert werden kann. »Wir
freuen uns riesig auf das Reservoir, deshalb
haben alle aus der Gemeinde beim Bau der
Staumauer geholfen. Unsere Honung ist,
dass bis zu einer Million Liter Regenwasser
gesammelt werden können und wir in der
Trockenzeit endlich Wasser zum Gießen un-
serer Beete und Felder haben!«
Bisher lief das Regenwasser ungenutzt
und viel zu rasant ab. Durch das Wasser-
reservoir können kurze Trockenperioden,
die immer wieder während der Regenzeit
auftreten, überbrückt werden. Wenn ge-
nug Wasser gespeichert wird, kann die An-
bauphase verlängert werden, auch über das
Ende der Regenzeit hinaus. Die Ernten wer-
den dadurch gesichert und erhöht. In einer
Region mit viel Hunger und Mangelernäh-
rung ist dies lebenswichtig. »Für den Boden-
und Wasserschutz panzen wir außerdem
Obstbäume. Sie spenden uns Schatten, re-
duzieren die Hitze und verbessern die Luft
und den Boden. Dadurch können wir bald
auch neue Obstsorten ernten, das ist beson-
ders schön!«, freut sich Herr Orellana.
Während der Bauarbeiten kamen Ge-
meindevertreter*innen aus der Nachbar-
gemeinde Plan de la Cruz auf MadreSelva
zu, die ebenso unter Wasserstress leiden.
Dort könnte ein ähnliches Wasserreservoir
gebaut werden. Das würde noch mehr Men
-
schen in der Region helfen, ihre Ernten trotz
Klimakrise und Dürren zu retten.
Ein neues Auangbecken in Guatemala lässt Wassermangel fast vergessen
Gute Ernte dank Regenwasserspeicherung
Sandra García neben ihrem neuen Tank, der bis zu 2500 Liter Regenwasser speichert
INKOTA
Frauen im Gutu-Distrikt in Simbabwe fördern selbstverwaltete Saatgutsysteme unter anderem durch den Tausch traditioneller Samen.
PELUM ZIMBABWE
2ndEXTRADonnerstag 21. November 2024

VANESSA KOHM, SODI
Drei Jahrzehnte nach den ersten freien
Wahlen 1994 sitzt Südafrika als stabile De-
mokratie und Mitglied der G20 sowie des
Brics-Bündnisses am internationalen Ver-
handlungstisch. Seine kulturelle Vielfalt
zelebriert Südafrika unter dem Begri der
Regenbogen-Nation. Der Übergang vom
Apartheidregime zur Demokratie brachte
weitreichende demokratische Rechte und
politische Befreiung. Doch wegen Korrup-
tion, hoher Arbeitslosenquoten, täglicher
Stromabschaltungen, einer maroden Inf-
rastruktur und extremer sozialer Ungleich-
heit ist von der anfänglichen Aufbruch-
stimmung nicht viel übrig geblieben.
Obwohl Südafrika 2023 nach Ägyp-
ten das höchste Bruttoinlandsprodukt Af-
rikas verzeichnete, leben 64 Prozent der
Schwarzen Südafrikaner*innen unter-
halb der Armutsgrenze. Diese Ungleich-
heit zeigt sich auch im Landbesitz: Rund
70 Prozent des Landbesitzes benden sich
nach den ins Stocken geratenen Land-
refor men immer noch in den Händen wei-
ßer Südafrikaner*innen, die nur 7 Prozent
der Bevölkerung ausmachen.
Eine intensive, marktorientierte Land-
wirtschaft, die durch einen hohen Einsatz
von Kunstdünger, Pestiziden und Maschi-
nen sowie durch große Farmen gekenn-
zeichnet ist, sichert die Lebensmittelver-
sorgung Südafrikas auf nationaler Ebene.
Aber die hohen Lebensmittelpreise sind
für viele Haushalte kaum noch bezahlbar.
In der Folge ist jeder zweite von Ernäh-
rungsunsicherheit betroen.
Vom hohen Technologie- und Indus tria-
li sierungsgrad der Metropolen ist in den
ländlichen Gebieten der Provinzen Limpo-
po, Ostkap und KwaZulu-Natal kaum et-
was zu spüren. Hier leben überwiegend
Schwarze Südafrikaner*innen. Viele von
ihnen wurden während der Apartheid
zwangsumgesiedelt. Arbeits- und Ausbil-
dungschancen sind rar. Viele der Familien
sind daher auf die geringen staatlichen
Leistungen angewiesen, die rund 80 Pro-
zent ihres Einkommens ausmachen.
Um über die Runden zu kommen, be-
treiben sie Viehzucht und Ackerbau auf
kommunalem Land. Doch die Böden
sind karg und überweidet; Wasser ist ein
knappes Gut. Der klimawandelbeding-
te Temperaturanstieg lässt die Verduns-
tungsraten steigen, verschärft die Was-
serknappheit weiter. Für die bäuerlichen
Familien wird es zunehmend schwieriger,
von ihrer Arbeit auf dem Land zu leben.
ISABELL NORDHAUSEN, INKOTA
Zentralamerika gehört zu den Regionen
der Welt, die am stärksten vom Klimawan-
del betroen sind. Steigende Temperatu-
ren, verheerende Dürren, Starkregen mit
Überschwemmungen, Hagel und Hurrika-
ne verursachen immer öfter schwere Ern-
teverluste. Das bedroht die Lebensgrund-
lage Tausender kleinbäuerlicher Familien.
Besonders betroen sind die Regionen im
sogenannte Trockenkorridor, der sich vom
Süden Mexikos bis nach Panama erstreckt
und anfällig für Dürren ist. Wenn der Re-
gen ausbleibt, vertrocknen die Ernten und
es folgt der Hunger. In Guatemala leben
56 Prozent der Menschen unterhalb der Ar-
mutsgrenze, davon 16 Prozent sogar in ex-
tre mer Armut. Fast die Hälfte der Kinder ist
chronisch mangelernährt, eine der höchs
-
ten Raten weltweit. Die Armut hat in den
Jahren seit der Corona-Pandemie noch zu-
genommen, und die Schere zwischen Arm
und Reich klat immer weiter auseinander.
Ein großes Problem ist der Wasserman-
gel. Wasser gilt als das kostbarste Gut der
Welt – und es ist im Trockenkorridor Zen-
tralamerikas oft besonders knapp. El Sal-
vador mit seinem tropischen Klima könnte
eigentlich genug Wasser haben. Im Schnitt
fällt deutlich mehr Regen als in Deutsch-
land. Er ist allerdings sehr ungleich übers
Jahr verteilt. Manchmal regnet es Hunder-
te Millimeter an nur einem Tag, manch-
mal bleibt es selbst in der Regenzeit wo-
chenlang trocken.
Die Extremwetterlagen nehmen durch
die Erderhitzung zu. Die Kleinbauernfa-
milien müssen um ihre Ernten bangen.
Zu den Klimaproblemen kommt noch ein
weiteres hinzu: die ungleiche Verteilung
von Macht und Ressourcen. Unternehmen
bekommen vom Staat viel schneller einen
Wasseranschluss als die Bewohner*innen
unzähliger Dörfer und der Armenviertel
der größeren Städte.
Internationale Konzerne verschärfen
die Wassernot. In der Grenzregion zwi-
schen Guatemala und El Salvador bedroht
die Gold- und Silbermine Cerro Blanco die
natürlichen Wasservorkommen der Regi-
on. Große Agrarrmen verschlimmern die
Situation, indem sie mit tiefen Brunnen
ihre Mega planta gen bewässern und mit
synthetischem Dünger das Wasser belas-
ten, insbesondere für den Anbau von Ex-
portgütern wie Zuckerrohr und Palm öl.
Zu leiden haben vor allem Kleinbau-
ernfamilien, ihr Zugang zu Wasser für
die regionale Landwirtschaft wird im-
mer schlechter. Selbst die Versorgung mit
Trinkwasser ist in vielen Gemeinden Zen-
tralamerikas nicht sicher, besonders für
Menschen, die arm sind.
30 Jahre nach dem Ende der Apartheid ist Südafrika
immer noch ein Land mit großer Ungleichheit
Guatemala und El Salvador liegen mitten im
Trockenkorridor von Zentralamerika
Ernüchterte Regenbogen-Nation
Chronischer Mangel
❚SÜDAFRIKA
❚ZENTRALAMERIKA
VANESSA KOHM, SODI
E
s ist früher Morgen, die Luft ist
noch frisch, als Slindile Mpin-
ga aus ihrem Haus tritt und
zum nahe gelegenen Was-
sertank geht. Mit routinier-
ten Handgrien önet die
27-jährige Bäuerin das Ventil des Tanks. Ein
leises Gluckern ist zu hören, dann plätschert
das Wasser in den Eimer, den sie darunterge-
stellt hat. Slindile Mpinga wird damit gleich
den Filtertopf der Tröpfchenbewässerung ih-
res Gemüsebeets auüllen, das unter einem
Schattennetz vor den hohen Temperaturen
in der prallen Sonne geschützt ist. Das Was-
ser kommt aus einer Quelle oberhalb von
Stulwane. Das Dorf liegt in der Nähe von
Bergville in der Drakensberg-Region in der
Provinz KwaZulu-Natal. Die Bewohner*in-
nen haben die Quelle vor zwei Jahren mit
Unterstützung der Mahlathini-Development
Foundation (MDF) erschlossen.
»Früher musste ich sehr weit laufen, um
Wasser zu holen«, erzählt Mpinga. »Die Er-
schließung der Quelle und das Leitungs-
system haben das Wasser näher an mein
Zuhause gebracht.« Die SODI-Partnerorga-
nisation hat sich zum Ziel gesetzt, kleinbäu-
erliche Fami lien in ländlichen Gebieten Süd-
afrikas bei der Anpassung an die Folgen des
Klimawandels zu unterstützen und ihre Le-
bensgrundlagen nachhaltig zu stärken. Ein
zentrales Element ihrer Arbeit ist die Verbes-
serung des Zugangs zu Wasser für die Subsis-
tenzlandwirtschaft und die Förderung eines
gemeindebasierten Wassermanagements.
In Südafrika ist Wasserverfügbarkeit ein
großes Thema. Viele Stauseen sind zwar gut
gefüllt, doch das Wasser kommt nicht bei
den Menschen an. Besonders in den ländli-
chen Regionen fehlt es an Infra struktur. »Ei-
gentlich ist die Wasserversorgung Aufgabe
der Kommunen. Doch es wird zu wenig in
die Infrastruktur investiert«, erklärt die Lei-
terin von MDF, Erna Kruger. Auch Stulwa-
ne ist nicht ans Wassernetz angeschlossen.
Trinkwasser beziehen die Haushalte über ei-
nen Tankwagen.
In der Trockenzeit von Mai bis August
kommt es in den ländlichen Gebieten Kwa-
Zulu-Natals zu erheblicher Wasserknapp-
heit. Durch den Klimawandel verschärft
sich die Situation, da die Verdunstung auf-
grund höherer Temperaturen zunimmt und
die Trockenzeiten länger werden. Der Tro-
ckenanbau ohne künstliche Bewässerung
stößt an seine Grenzen. In der Region Kwa-
Zulu-Natal wirkt sich der Mangel an Was-
ser bereits spürbar auf die Ernten aus. Die
noch drastischere Lage in wärmeren Provin-
zen zeigt, was auf die Bauern und Bäuerin-
nen zukommt: »In Limpopo haben Bäuerin-
nen, die ihre Felder nicht bewässern können,
bereits im fünften Jahr in Folge mit Ernte-
ausfällen zu kämpfen«, erklärt Kruger.
Die Bewohner*innen von Stulwane ha-
ben die Verbesserung ihrer Wasserver-
sorgung selbst in die Hand genommen.
Unterstützt werden sie dabei von den MDF-
Fachkräften. »Ein hydro lo gisches Team der
Universität von Kwa Zulu-Natal kartier-
te potenzielle Wasserquellen und geeigne-
te Standorte für Bohrlöcher rund um Stul-
wane. Gemeinsam wurde die Auswahl nach
Zugänglichkeit und Wasserdurchuss einge-
schränkt. Im November 2021 haben wir ei-
nen Agraringenieur hinzugeholt, um das
technische Potenzial der Quellen zu be-
werten«, sagt Kruger. In zwei Workshops
erarbeiteten die Dorfbewohner*innen ge-
meinsam mit ihm drei Konzepte für die Er-
schließung der Quellen.
Auf einer Vollversammlung entschieden
sie sich für ein Konzept, das die Nutzung
einer bislang vor allem von Vieh genutzten
Quelle vorsieht. Diese Quelle wird nun teil-
weise unterirdisch gefasst und speist über
Rohrleitungen zwei Sammeltanks mit einem
Fassungsvermögen von je 10 000 Litern so-
wie Entnahmetanks in der Nähe einzelner
Häusergruppen. Das System arbeitet nach
dem Schwerkraftprinzip. Das Wasser ießt
allein durch das natürliche Gefälle des Ge-
ländes. Da es ohne Pumpen auskommt, ist
es wartungsarm und verursacht kaum lau-
fende Kosten. So erhalten 28 der 99 Haus-
halte rund 380 Liter pro Tag – etwa zwei
Badewannenfüllungen.
Eine weitere Quelle ussabwärts bleibt
unangetastet, damit sie weiterhin allen in
vollem Umfang zur Verfügung steht. Ge-
meinsam mit den MDF-Fachkräften verleg
-
ten die beteiligten Familien die Leitungen
und Sammeltanks. Unter Anleitung hoben
die Bewohner*innen 20 Kilometer Gräben
aus, um ein gleichmäßiges Gefälle zu ge-
währleisten, sodass die Tanks über Nacht
automatisch befüllt werden können, ohne
dass Luftblasen den Wasseruss stören. Ne-
ben ihrer Arbeitskraft trugen die Bewoh-
ner*innen auch einen nanziellen Eigenan-
teil zur Beschaung der Rohre und Tanks.
MDF befähigt die Dorfbewohner*innen
in Schulungen, ihre Wasserversorgung ei-
genständig sowie eektiv und nachhaltig zu
managen. Sie werden dabei unterstützt, sich
in Wasserkomitees zu organisieren, in de-
nen sie die Wasserverteilung, Wartung und
Qualitätskontrolle organisieren. MDF ver-
mittelt zudem Methoden für einen fairen In-
teressenausgleich zwischen den Wassernut-
zer*innen, um den sozialen Zusammenhalt
zu stärken und die Ökosysteme zu schüt-
zen. »Unsere Erfahrung zeigt, dass dies nur
mit strengen, gemeinschaftlich erarbeiteten
Regeln gelingt. Deshalb unterstützen wir die
Wasserkomitees bei der Ausarbeitung von
Statuten. Es gibt Beispiele von Wasserkomi-
tees, die seit über 20 Jahren aktiv sind«, er-
klärt Erna Kruger. Sie und ihr Team ermuti-
gen Dorfgemeinschaften, sich ebenfalls bei
den staatlichen Wasserbehörden für ihre Be-
lange einzusetzen. Interessierte Gemeinden
werden beispielsweise bei der Gründung
von Wasserwirtschaftsausschüssen und bei
der Teilnahme an den regionalen Wasserfo-
ren unterstützt.
Nelisiwe Msele ist im Wasserkomitees in
Stulwane aktiv. Durch den verbesserten Zu-
gang zu Wasser und Schulungen von MDF
zu ressourcenschonenden und klimaresili-
enten Anbaumethoden konnte die 51-Jäh-
rige ihre Felder vergrößern und die Erträ-
ge steigern. Heute bewirtschaftet sie eine
1000 Qua drat meter große Parzelle, auf der
sie Gemüse nicht nur für den Eigenbedarf,
sondern auch für den Verkauf anbaut. »Die
Teilnahme am Projekt hat meinen Traum
vom eigenen Geschäft wahr werden las-
sen«, sagt sie.
Insgesamt unterstützen SODI und MDF
rund 500 bäuerliche Familien in den Provin-
zen Limpopo, Ostkap und Kwa Zulu-Natal
dabei, mit agrarökologischen Methoden und
der Verbesserung ihrer Wasserversorgung
die Herausforderungen des Klimawandels
zu bewältigen. Aktuell plant Nelisiwe Msele
mit ihren Nachbar*innen die Erschließung
der nächsten Wasserquelle. Damit soll der
Zugang zu Wasser für weitere 75 Kleinbau-
ernfamilien in Stulwane verbessert werden.
MDF und SODI unterstützen in Südafrika den Aufbau
einer selbstverwalteten Wasserversorgung
Wasser für alle
Die Verbesserung des Wasserzugangs ist in Südafrika Ziel der Solidaritätskampagne.
SODI
ISABELL NORDHAUSEN, INKOTA
In der Grenzregion zwischen Guatema-
la und El Salvador bedroht die Gold-
und Silbermine Cerro Blanco die na-
türlichen Wasservorkommen der Region.
INKOTA- Partnerorganisationen, das Kollek-
tiv Madre Selva (CMS) und Unidad Ecoló-
gica Salvadoreña (UNES), unterstützen die
betroenen Menschen dabei, sich für sau-
beres Wasser ohne Gift einzusetzen.
Seit vielen Jahren schwelt der Streit um
die Mine im Einzugsgebiet des Flusses Os-
túa. Im Januar 2024, nur fünf Tage vor dem
Ausscheiden aus seinem Amt, genehmigte
der damalige guatemaltekische Präsident
Alejandro Giammattei dem kanadischen
Bergbauunternehmen Bluestone Resources
noch schnell die Erweiterung ihrer Lizenz:
statt ausschließlich Untertagebau nun auch
oener Tagebau mit Schürferlaubnis von
jährlich vier Millionen Tonnen. Und dies,
obwohl eine Nachbarschaftsbefragung
2022 zu einem eindeutigen Ergebnis kam:
Fast 90 Prozent der Bürger*innen im be-
troenen Landkreises Asunción Mita sind
gegen das Tagebauprojekt!
Die lokale Bevölkerung wie auch Um-
weltorganisationen befürchten: Wird das
Vorhaben durchgesetzt, droht eine humani-
täre und ökologische Katastrophe zugleich.
»Das geplante Rückhaltebecken im Cerro
Blanco wäre das zweitgrößte auf dem Kon-
tinent. Die nächste Siedlung, mit 200 Fami-
lien, liegt nur knapp 400 Meter vom vorge-
sehenen Standort entfernt. Das Risiko ist
einfach zu groß«, sagt Julio González, Bio-
loge vom Kollektiv MadreSelva.
Die Bewohner*innen haben vor allem
Angst vor der Verseuchung ihres Grundwas-
sers. Um Gold und Silber zu gewinnen, wer-
den giftige Chemikalien eingesetzt, die die
Metalle aus dem abgebauten Gestein lösen.
Werden die Rück stände der Chemikalien
nicht fachgerecht aufgefangen, gelangen
sie in die natürlichen Wasservorkommen.
Das ist eine Gefahr für Mensch und Umwelt
– auf beiden Seiten der Grenze.
Durch den Landkreis Asunción Mita
ießt der Fluss Ostúa. Dieser mündet in den
zwischen Guatemala und El Salvador gele-
genen Grenzsee Güija. Von dort wird der
Lempa gespeist, der längste und wichtigste
Fluss El Salvadors. Darum werden die Ent-
wicklungen in Asunción Mita auch auf sal-
vadorianischer Seite intensiv verfolgt.
»Durch das gemeinsame Vorgehen in El
Salvador und Guatemala bündeln wir unse-
re Kräfte und können unseren Forderungen
nach Umweltschutz und Erhalt der natür-
lichen Lebensgrundlagen mehr Nachdruck
verleihen«, sagt Carolina Amaya, salvadori-
anische Umweltorganisation UNES.
Mit der Amtsübernahme des neuen gua-
temaltekischen Präsidenten Bernardo Aré-
valo im Januar 2024 keimt neue Honung.
Er hat die Umweltlizenz für Cerro Blanco
erneut überprüfen lassen und dabei zahl-
reiche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Im
Juni 2024 hat die Regierung die Umweltli-
zenz deshalb widerrufen und das Bergbau-
unternehmen angewiesen, eine neue Um-
weltverträglichkeitsstudie in Auftrag zu
geben. Damit ist das Tagebauprojekt zwar
erst mal gestoppt, das Bergbauunterneh-
men hat jedoch bereits Einspruch dagegen
eingelegt.
Zudem ist ungewiss, ob der Tagebau in
Zukunft nicht doch erneut genehmigt wird.
Die US-Botschaft in Guatemala appellierte
bereits im Juni 2023 an das zuständige gu-
atemaltekische Ministerium, das Genehmi-
gungsverfahren voranzubringen. Es stehen
internationale Interessen und eine Menge
Geld auf dem Spiel.
Bürger in Guatemala und El Salvador arbeiten zusammen gegen Umweltverschmutzung durch Bergbau
Wasser kennt keine Grenzen
ndEXTRA DonnerstagFreitag, 21. November 20243

SIMBABWE: Wissen teilen
Für 240Euro können kleinbäuerliche Gemein-
schaften und Organisationen ihr wertvolles Wis-
Für 80 Euro können zwanzig Obstbaumsetzlinge
Ernte teilen
SÜDAFRIKA: Erfahrungen teilen
Mit 43 Euro unterstützen Sie einen
Bauern oder eine Bäuerin in einem zwei-
tägigen Training dabei, klimaresiliente
Anbautechniken zu erlernen.
JETZT SPENDEN!
Online spenden:
https://dasND.de/solispende
Solidarität weltweit
Kennwort »SOLIAKTION«
IBAN: DE80 3702 0500 0001 020102
BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)
2023/24
2024/25
Spendenziel:
60.000 €
Spendenbarometer:
57.359,03 €
Mit Ihrer Hilfe
wird es möglich!